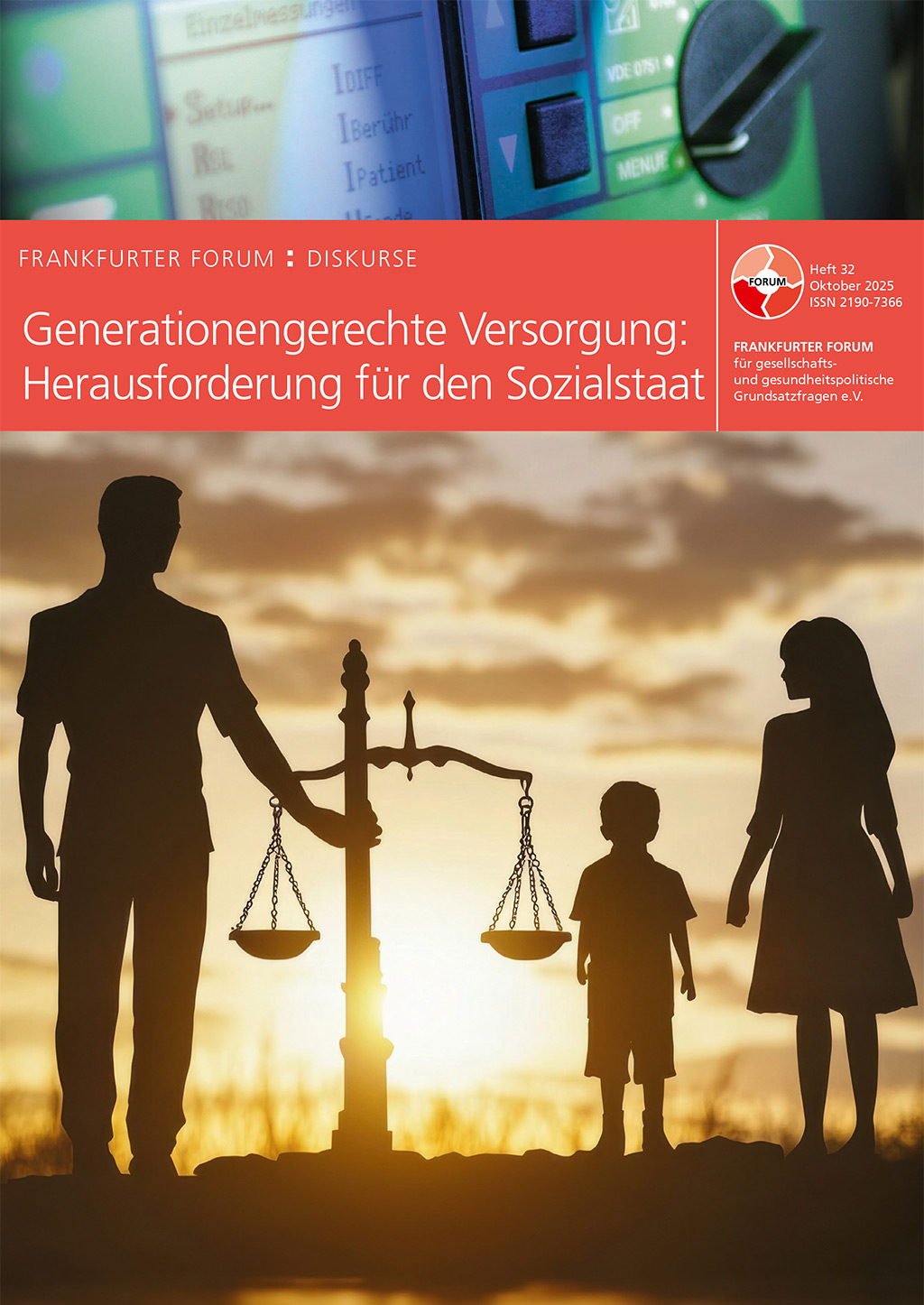HEFT NR. 32
Generationengerechte Versorgung: Herausforderungen für den Sozialstaat
Das Frankfurter Forum nimmt sich in Heft 32 dem vielschichtigen Forschungsfeld der generationengerechten Gesundheit an. Dabei werden gegenwärtig verstärkt intergenerative Gesichtspunkte diskutiert: Wie werden künftige Verteilungskonflikte um die immer knapper werdenden Gesundheitsressourcen gelöst? Wie belastbar ist der durch ein Umlagesystem finanzierte Generationenvertrag, der durch den demografischen Wandel an Grenzen stößt?
Mit Blick auf die aktuelle Lage muss man konstatieren, dass Kranken- und Pflegeversicherung nicht gut für die Zukunft aufgestellt sind. Hinzu kommt ein massives Effizienz- und Ausgabenproblem. Die Politik hat mit einer freigiebigen Gesetzgebung hohe Ausgabensteigerungen mitverursacht, während Effizienzaspekte und Reformen auf der Einnahmenseite weitgehend unterblieben sind.
In Heft 32 „Generationengerechte Versorgung: Herausforderung für den Sozialstaat“ wird diese Problematik aus einer interdisziplinären Perspektive beleuchtet.
Professor Dr. Stefan Huster, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Rechtsphilosophie an der Ruhr-Universität Bochum, diskutiert das Thema am Beispiel der Krankenhausreform und kommt zu einem skeptischen Fazit. Mit dem KHVVG ist das Fundament der zukünftigen Krankenhausstruktur gelegt, aber diese Struktur muss erst noch mit einer Vielzahl legislativer Akte aufgebaut werden. Zwar stellt die „demographische Zange“ aus steigendem Versorgungsbedarf und gleichzeitig abnehmendem Versorgungspersonal den maßgeblichen Grund für die Notwendigkeit einer Reform der Krankenhausstruktur dar. Dabei ist das Verhältnis der Generationen – oder genauer: der Kohorten der „Boomer“ und der später Geborenen – generell für die Reform der Sozialsysteme von zentraler Bedeutung. Doch weniger klar sei, ob und in welchem Sinne sich aus einem Postulat der „Generationengerechtigkeit“ auch Vorgaben für die Ausgestaltung dieser Reform ergeben.
Professorin Dr. Dr. Eva Winkler, Leiterin des Instituts für Medizin- und Datenethik an der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg und Mitglied des Geschäftsführenden Direktoriums des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg, verhandelt in ihrem Beitrag, was generationengerechte Gesundheitsversorgung mit Blick auf Bedarfs-, Verteilungs- und Chancengerechtigkeit bedeutet. Aus medizinethischer Perspektive diskutiert sie Kriterien für eine gerechte Verteilung knapper Ressourcen im Gesundheitswesen und stellt dazu materiale Kriterien wie Bedürftigkeit, erwarteter Nutzen und Kosten-Nutzen-Relation sowie prozedurale Ansätze vor. Diese Kriterien beschreiben zwar, wie knappe Ressourcen gerecht verteilt werden können – die vorgelagerte Frage, was mit einer gerechten Verteilung überhaupt erreicht werden soll, bleibt aber unbeantwortet. Generationengerechtigkeit im Gesundheitswesen, so die Autorin, bedeutet, sowohl die Bedarfe unterschiedlicher Lebensphasen als auch die langfristige Tragfähigkeit des Systems für künftige Generationen zu berücksichtigen. Zentrale Dimensionen dafür sind die Bedarfsgerechtigkeit über den Lebensverlauf, Stabilität und Nachhaltigkeit sowie gleiche Chancen auf Gesundheit.
Professorin Dr. Amelie Wuppermann, Inhaberin des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre III: Finanzwissenschaft an der Universität Bayreuth, beleuchtet in ihrem Beitrag, in welchem Umfang der Generationenvertrag in der GKV unter den aktuellen und prognostizierten Rahmenbedingungen tragfähig bleibt, und welche Reformoptionen zu einer Erhöhung der Generationengerechtigkeit beitragen können. Ohne Reformen werden Beitragssätze weiter steigen oder Leistungskürzungen notwendig, wodurch die Akzeptanz nachfolgender Generationen gefährdet wird. Einnahmenseitige Reformen – wie die Einbeziehung weiterer Einkommensarten, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit oder eine teilweise Kapitaldeckung – bieten kurzfristig und mittelfristig Potenzial zur Entlastung. Auf der Ausgabenseite könnte vor allem eine Stärkung der Anreize zur Förderung eines gesunden Lebensstils – auch für Leistungserbringer und Krankenkassen – sinnvoll sein. Ergänzend können präventive Steuerinstrumente und Investitionen in Humankapital helfen, die langfristige Tragfähigkeit des Systems zu sichern.
Professorin Dr. Adelheid Kuhlmey, Seniorprofessorin an der Charité-Universitätsmedizin Berlin und Gründungsvorstand Wissenschaft der Universitätsmedizin Lausitz – Carl Thiem, fordert in ihrem Beitrag, dass Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation zu starken Komponenten des Gesundheitssystems werden müssen. Heute ist das System nahezu exklusiv auf die Versorgung von Defiziten bei pflegebedürftigen Menschen ausgerichtet. Benötigt wird ein Paradigmenwechsel hin zur Stärkung der vorhandenen physischen, psychischen und sozialen Ressourcen alter Menschen – auch bei bereits eingeschränkter Gesundheit und Pflegebedürftigkeit. Ziel präventiver Interventionen ist die Maximierung von Gewinnen und die Minimierung von Gesundheitsverlusten im Lebensverlauf. Für einen solchen Ansatz auch noch in den höheren und hohen Lebensjahren sprechen Befunde, die positive Effekte auf den Erhalt der Selbstständigkeit z. B. durch gezieltes Training körperlicher Mobilität und geistiger Leistungsfähigkeit, durch soziale Teilhabe und Vermeidung von Einsamkeit oder durch eine gesunde Ernährung nachweisen.
Professor Dr. Wolfgang Hoffmann, MPH, Leiter der Abteilung Versorgungsepidemiologie und Community Health und Geschäftsführender Direktor des Instituts für Community Medicine an der Universitätsmedizin Greifswald, und Professorin Dr. Neeltje van den Berg, stellvertretende Leiterin der Abteilung Versorgungsepidemiologie und Community Health des Instituts für Community Medicine an der Universitätsmedizin Greifswald, plädieren in ihrem Beitrag für regionale sektorenübergreifende Versorgungsmodelle, beispielsweise Medizinische Versorgungszentren, Versorgungsnetze, populationsbasierte Vergütungsmodelle und Telemedizin. Diese können die Integration medizinischer, pflegerischer, therapeutischer und sozialer Leistungen fördern, Versorgungslücken wirkungsvoll adressieren und zu einer bedarfsgerechten Versorgung beitragen. Kontinuierliches Monitoring dient der Qualitätssicherung und -verbesserung und kann ein „lernendes Gesundheitssystem“ unterstützen. Dezentralität der Angebote, eine umfassende gemeinsame Datenbasis, klare Arbeitsteilung, Koordination und Governance können die Resilienz im deutschen Gesundheitssystem steigern. Die regionale Versorgung, so die Autoren, sei als ein verbindendes Element im komplexen und zunehmend heterogenen deutschen Gesundheitssystem eine vielversprechende Lösungsoption.
Frankfurter Forum e. V.
Seedammweg 51
D-61352 Bad Homburg
+49 152 389 52 463
petra.acher@frankfurter-forum-diskurse.de
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufendem und erhalten Sie alle aktuellen Publikationen und Neugikeiten.
Unsere Partner: