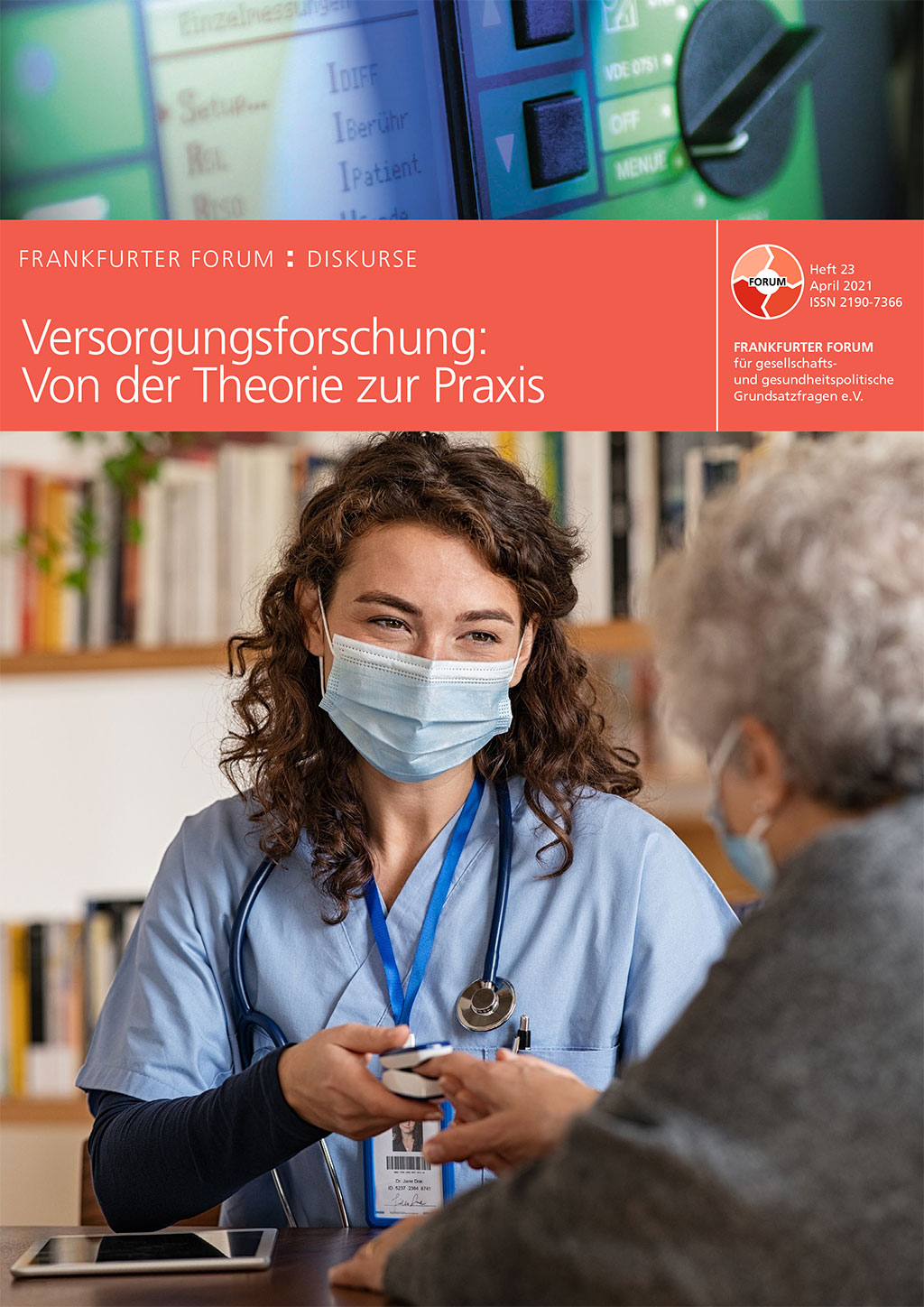HEFT NR. 23
Vorsorgungsforschung : Von der Theorie zur Praxis
Die Versorgungsforschung in Deutschland bleibt bisher hinter ihren Möglichkeiten zurück. Ein wesentlicher Grund dafür ist die unzureichend erschlossene digitale Infrastruktur im Gesundheitswesen. Zwar ist durch digitale Abrechnungsprozesse zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen längst ein großer digitaler Datenschatz entstanden. Doch dieser ist bislang der breiten Nutzung durch Versorgungsforscher entzogen. Bisher muss häufig auf Datenquellen aus dem Ausland zurückgegriffen werden, um patientenrelevante Informationen beispielsweise zur Modellierung von Versorgungsprozessen zu erhalten.
Zwischen den Hoffnungen auf eine datengestützte Versorgung sowie einer entsprechenden Versorgungsplanung und ihrer Umsetzung liegen noch viele nötige regulatorische Schritte des Verordnungs- und Gesetzgebers. Vor diesem Hintergrund hat sich das Frankfurter Forum, das Ende Oktober 2020 eigentlich in Fulda als Präsensveranstaltung stattfinden sollte, mit verschiedenen Facetten der Versorgungsforschung und der guten Versorgungsrealität beschäftigt. Die Tagung trug ursprünglich den Generaltitel „Versorgungsforschung auf dem Weg von der Theorie in die Praxis – Beispiele guter Versorgungsrealität“.
Professor Dr. Wolfgang Greiner und Dr. Julian Witte, Universität Bielefeld, skizzieren in ihrem Beitrag die künftige Rolle der Digitalisierung in der Versorgungsforschung. Sie werben dafür, nicht mehr auf die ideale, systemweite Lösung zur Digitalisierung von Prozessen zu warten, sondern sich ggf. auch mit pilothaften Schritten einer praktikablen und langfristig angemessenen Lösung zu nähern. GKV-Abrechnungsdaten nähmen unter den bereits vorhandenen Datenquellen einen besonderen Rang ein – sie würden schon heute etwa für die Evaluation von Projekten des Innovationsfonds genutzt. Daneben gebe es eine Vielzahl von Registern mit teilweise noch überschaubaren Patientenzahlen. Doch deren Potenzial für die Versorgungsforschung sei angesichts mangelnder Koordination, Kooperation und Zugänglichkeit dieser Register noch nicht annähernd ausgeschöpft. Greiner und Witte zeigen am Beispiel der Auswertung von stationären Abrechnungsdaten, dass die für die Erwachsenenbevölkerung im Frühjahr 2020 beobachtete „Corona-Delle“ auch die Krankenhausaufenthalte von Kindern und Jugendlichen betroffen hat.
Professor Dr. Ulrich Hegerl, Johann Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt am Main und Stiftung Deutsche Depressionshilfe, beschäftigt sich in seinem Beitrag mit der Suizidprävention und -assistenz auch im Lichte des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020. Darin hatte das Gericht das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung für verfassungswidrig erklärt. Studien zur Suizidprävention indes betonten übereinstimmend die zentrale Bedeutung psychiatrischer Erkrankungen als Ursache suizidaler Handlungen. Durch retrospektive Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass eine oder mehrere schwere Erkrankungen keine nennenswerte kausale Rolle bei Suiziden gespielt haben. Dies zeige die Gefahr auf, wenn Depression und Suizidalität vorschnell als vermeintlich nachvollziehbare Reaktionen auf bestehende körperliche Einschränkungen gesehen werden – und nicht als eigenständige, krankhafte Zustände. Vor diesem Hintergrund wertet Hegerl das Karlsruher Urteil kritisch: Zwar verbinde sich einerseits mit der „Normalisierung“ des Suizids die Hoffnung, dass sich mit der Entstigmatisierung auch das Hilfesuch-Verhalten suizidgefährdeter Menschen verändert, so dass ihre Chance steigt, professionelle Hilfe zu erhalten. Andererseits bestehe die Gefahr, dass der (assistierte) Suizid in Folge des Urteils zu einer offiziell geregelten Wahlmöglichkeit wird, die mit einem Rechtsanspruch verbrieft ist und so die Schwelle für suizidales Verhalten senke.
Professor Dr. Friedrich Köhler und Dr. Sandra Prescher, Arbeitsbereich kardiovaskuläre Telemedizin an der Charité, diskutieren in ihrem Beitrag die Potenziale des Telemonitorings als einer telemedizinischen Methode innerhalb der digitalen Kardiologie. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat am 17. Dezember 2020 das Telemonitoring bei Herzinsuffizienz als eigenständige Methode anerkannt und somit erstmals ein digitales Verfahren in den Leistungskatalog der GKV aufgenommen. Da sich daraus für gesetzlich Versicherte ein grundsätzlicher Leistungsanspruch auf diese Versorgungsform ableite, ergäben sich durch den nun anstehenden Translationsprozess von der klinischen Studie hin zur Anwendung im Regelbetrieb besondere Herausforderungen. Denn die Betreuungskapazität der an den Studien beteiligten Telemedizinzentren (TMZ) lag bei maximal 500 parallel betreuten Patienten. Im G-BA-Beschluss wird aber ein Bedarf für Telemonitoring bei etwa bundesweit 200.000 Patienten angenommen. Eine mögliche Umsetzungsoption besteht für die Autoren darin, in telemedizinischen Netzwerken die Verknüpfung von kardiologischen Praxen mit einem überregionalem TMZ in einem Krankenhaus sicherzustellen, dass außerhalb der Praxiszeiten die Mitbetreuung von Notfällen übernimmt.
Professor Dr. Monika Kellerer, Ärztliche Direktorin der Klinik für Innere Medizin I am Marienhospital in Stuttgart, verhandelt in ihrem Beitrag die Frage, welche Bedürfnisse und Wünsche Patienten mit Diabetes haben. Die medizinische und gesundheitsökonomische Bedeutung dieser Erkrankung sei in Deutschland enorm, denn fast jeder fünfte Todesfall ist durch Folge- und Begleiterkrankungen wie Herzkreislauf-Erkrankungen mit Typ-2-Diabetes assoziiert. Doch obwohl diese chronische Erkrankung anhaltend den Alltag der davon Betroffenen prägt und deren gesundheitliche Lebensqualität deutlich verringert, fehlten in Deutschland bislang die gesamte Population umfassende Studien, die die Bedürfnisse und Wünsche insbesondere älterer Menschen mit Diabetes erfassen. Als Folge sähen Wissenschaftler die Bedürfnisse dieser Patienten bislang durch eine Tunnelperspektive. Dies sei umso irritierender, als nationale wie internationale Diabetes-Leitlinien die partizipative Entscheidungsfindung zwischen Arzt und Patienten in den Fokus stellen. Dabei ließen Präferenzstudien aus unterschiedlichen Ländern erkennen, inwiefern sich Patientenwünsche von denen ihrer behandelnden Ärzte unterscheiden.
Professor Dr. Wolfgang Hoffmann und Professor Dr. Neeltje van den Berg, Universitätsmedizin Greifswald, beschreiben in ihrem Beitrag die großen Herausforderungen und die neuen Möglichkeiten der Versorgungsforschung in der Onkologie. Sie verweisen darauf, dass die Häufigkeit von Krebserkrankungen mit steigendem Alter zunehme. Zugleich litten immer mehr Krebspatienten unter einer oder mehreren zusätzlichen chronischen Erkrankungen. Zudem habe die veränderte Altersverteilung und Morbiditätsstruktur auch Auswirkungen auf die Therapieziele. Statt einer alleinigen Fokussierung beispielsweise auf das Fünfjahres-Überleben würden differenzierte, individuelle Therapieziele wie die Vermeidung von therapiebedingten Langzeitschäden oder patientenbezogene Ziele wie Symptomkontrolle, Lebensqualität oder psychische Gesundheit immer wichtiger. Diese Therapieziele erforderten eine ausreichende Evidenzbasis, die in vielen Fällen aber nicht allein durch randomisierte klinische Studien (RCT) gewonnen werden kann. Vor diesem Hintergrund müssten zunehmend andere Studiendesigns und Datengrundlagen herangezogen werden. Eine wichtige Grundlage dafür bildeten die klinischen Krebsregister. So könne auf Basis dieser Registerdaten die Wirksamkeit von Medikamenten, die in RCT nachgewiesen wurde, unter realen Versorgungsbedingungen untersucht werden.
Professor Dr. Jürgen Zerth, Wilhelm Löhe Hochschule in Fürth, skizziert in seinem Beitrag die Pflege von morgen und legt dabei einen Fokus auf den vermeintlichen Care-Mix zwischen Mensch und Pflegeroboter. Neue Pflegetechnologien würfen die Frage danach auf, welche methodischen Ansätze der Versorgungsforschung existieren, mit deren Hilfe sowohl die Auswahlentscheidung als auch die nachträglichen Implementierungsbedingungen einer neuen Pflegetechnologie in einer Technologieempfehlung abgebildet werden können. Denn die einfache Übertragung von Innovationsanalogien anderer Branchen auf die Implementierung von Pflegetechnologien gehe fehl. Technik sei im Kontext der Pflege eine spezifische Form der Assistenz – in personaler, organisatorischer oder technischer Hinsicht. Es sei verwunderlich, dass bisher Übersichtsarbeiten, die Akzeptanz-, Effektivitäts- und Effizienzaspekte digitaler Pflegetechnologien ausloten, spärlich gesät sind. Nur wenige Arbeiten hätten sich dagegen bisher mit Fragen der langfristigen Evidenz oder mit pflegerelevanten Outcome-Aspekten beschäftigt. Im Ergebnis sei die Bedeutung von Pflegetechnologien im Hinblick auf den Care- und Case-Mix in der Pflege auch gesundheitspolitisch noch wenig diskutiert.
Frankfurter Forum e. V.
Seedammweg 51
D-61352 Bad Homburg
+49 152 389 52 463
petra.acher@frankfurter-forum-diskurse.de
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufendem und erhalten Sie alle aktuellen Publikationen und Neugikeiten.
Unsere Partner: